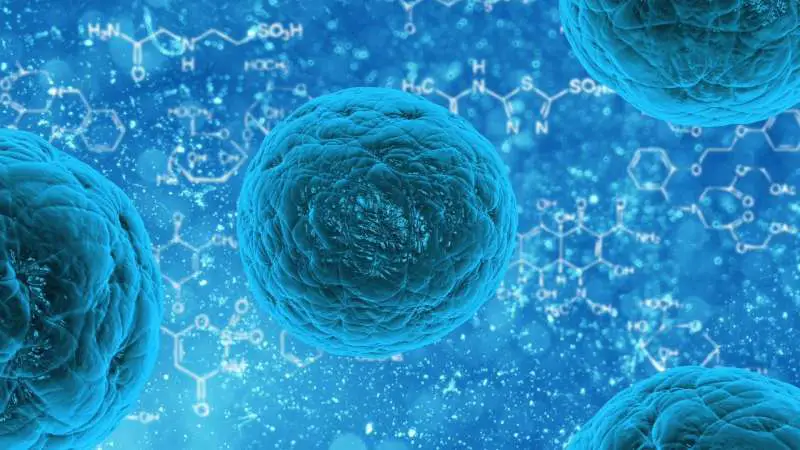Forscher widerlegen 50 Jahre alte Lehrmeinung zur Regulation der Zellmembran
Bio-News vom 06.02.2020
Die Zellmembran ist die Grenze zwischen Leben und Nicht-Leben. Dass sich die Zellhülle auf Umweltbedingungen wie die Temperatur einstellt, ist essentiell für alle Lebensformen. Bisherige Lehrmeinung war, dass Zellen die Flüssigkeit ihrer Membranhülle messen, um sich an die Temperatur anzupassen. Dieses 50 Jahre alte Dogma ist aber falsch, haben Forscherinnen und Forscher in einem gemeinsamen Projekt festgestellt. Ihre Erkenntnisse sind heute im Fachmagazin „Nature Communications“ erschienen.
Die Grenze zwischen Leben und Nicht-Leben ist eine denkbar schmale. Im biowissenschaftlichen Sinn ist dies die nur wenige Nanometer (Millionstel Millimeter) dicke Zellmembrane, die aus zwei aufeinanderliegenden Lipidschichten besteht. Deren Funktionieren ist für das Überleben der Zelle essentiell. Ist die Hülle funktionsuntüchtig, stirbt die Zelle.
Publikation:
Stephanie Ballweg, Erdinc Sezgin, Milka Doktorova, Roberto Covino, John Reinhard, Dorith Wunnicke, Inga Hänelt, Ilya Levental, Gerhard Hummer & Robert Ernst
Regulation of lipid saturation without sensing membrane fluidity
Nature Communications 11, 756 (2020)
DOI: 10.1038/s41467-020-14528-1
„Diese Grenze ist aber viel mehr als nur ein teilweise durchlässiger ‚Maschendrahtzaun‘“, erläutert Robert Ernst, dessen wissenschaftlicher Fokus auf der Erforschung dieser winzigen Hülle liegt und die ihn fasziniert: „Zellmembranen sind erstaunliche Materialien, die unter bizarren, uns kaum vorstellbaren Bedingungen existieren: Dort herrschen extreme Drücke von vielen hundert Atmosphären. Gleichzeitig sind sie extrem dehnbar, robust und selbst-reparierend. Die Zellmembran schützt das Innere der Zelle gegen physikalischen und chemischen Stress, dient zum Signalaustausch und als Nährstoffkanal und hält Krankheitserreger ab“, erläutert der Professor für Molekularbiologie.
Bei all diesen Aufgaben muss sie natürlich im Blick haben, dass sie funktionstüchtig bleibt. „Die Zellmembran reguliert sich selbst, je nachdem, in welcher Umgebung sie sich befindet.“ Als Vergleich wählt Robert Ernst das Bild eines Rentiers, dessen Hufe im arktischen Permafrostboden stehen, während der Kopf 37 Grad Körpertemperatur aufweist. „Und in allen Bereichen des Rentiers funktionieren die Zellen gleich gut“, sagt er.
Seit rund 50 Jahren meinte man zu verstehen, woher eine Zellmembran „weiß“, welche Bedingungen gerade herrschen und was sie dementsprechend tun muss, um zu überleben: Sie misst die Flüssigkeit der Plasmamembran, die bei tiefen Temperaturen zähflüssiger wird und sogar gefrieren kann, so die einhellige Meinung. Nur eine flüssige Membran erlaubt nämlich einen effektiven Austausch von Signalen, eine Aufnahme von Nährstoffen in die Zelle und einen Abtransport von Zellgiften.
Je nach Flüssigkeit der Membran stellt sich die Zelle auf ihre Umgebungsbedingungen ein. Ist es, um im Bild des Rentiers zu bleiben, zu kalt an den Füßen, droht die Flüssigkeit „einzufrieren“ und die einzelnen Bestandteile der Zellmembran, die Lipide, rücken dichter zusammen. Im extremen Fall würden die lebenswichtigen Prozesse der Zellmembran erstarren. Das andere Extrem ist auch nicht gut. Denn sind die Lipide zu weit auseinander, verliert die Membran ihre schützende Funktion, wird zu flüssig und die Zelle stirbt ab. Die Zellmembran muss also das richtige Maß für die die Flüssigkeit der Membran finden. Und das tut sie, indem sie die Flüssigkeit im Auge behält. Das ist logisch und nachvollziehbar.
„Aber das ist leider falsch“, sagt Robert Ernst.
Gemeinsam mit der Erstautorin Stephanie Ballweg, seinem Team an der Universität des Saarlandes und weiteren Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien, Deutschland und den USA haben sie diese 50 Jahre alte Lehrmeinung dieser sogenannten „homöoviskosen Adaption“, die zum Kanon der Biowissenschaften gehört, widerlegt. „Wir haben den Sensor isoliert und seine Reaktion auf die Flüssigkeit der Membran untersucht“, erläutert der Biologe. „Nach der bisherigen Lehrmeinung müsste der Sensor angeschaltet werden, wann immer die Membran zähflüssiger wird und die Lipide sich langsamer bewegen“, erläutert er das Vorgehen.
„Das allerdings ist nicht der Fall.“ Tatsächlich ist es die Packungsdichte von Lipidatomen in einem speziellen Bereich der Membran, der entscheidet, ob der Sensor reagiert. „Das erlaubt es dem Sensor sogar, zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren in den Membranlipiden zu unterschieden“, erklärt er die Ergebnisse, die den Lehrsatz, der ein halbes Jahrhundert lang gültig war, hinwegfegt.
Und warum ist bisher noch niemand auf diese Idee gekommen? „Bisher sind interdisziplinäre Forschungsprojekte auf diesem Gebiet noch eher selten“, führt Robert Ernst aus. „Wir haben für dieses Projekt Expertinnen und Experten aus theoretischer Physik, Materialwissenschaft und Biochemie zusammengebracht, um dieser Frage nachzugehen.“ Nur durch die Synergie zwischen diesen Disziplinen war es möglich, den bisher angenommenen Mechanismus tatsächlich zu prüfen.
Mit der neuen, fundamentalen Erkenntnis können Biowissenschaftler und Biowissenschaftlerinnen in aller Welt nun weitere Forschungsfragen entwickeln und auf neuartige Weise untersuchen, wie biologische Membranen die Funktion von Membranproteinen und Signalprozesse zwischen einzelnen Zellen steuern.
Diese Newsmeldung wurde mit Material der Universität des Saarlandes via Informationsdienst Wissenschaft erstellt.